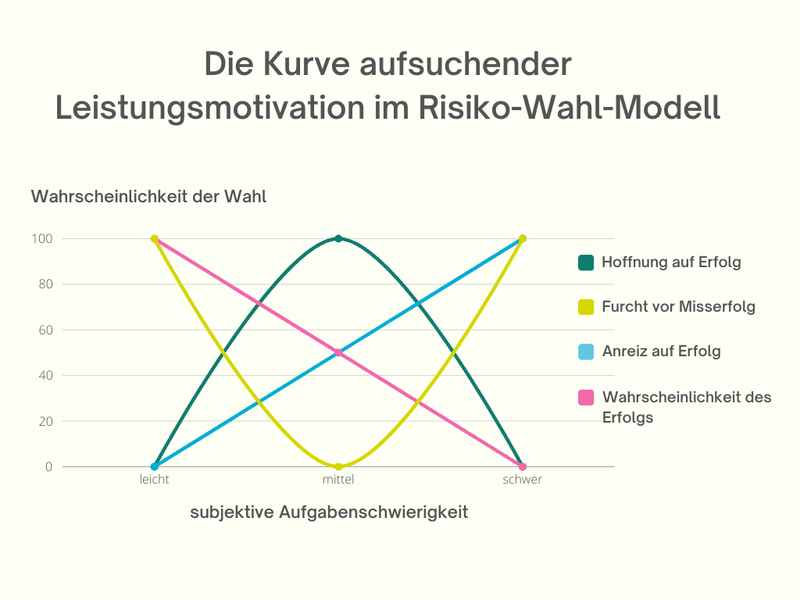Arbeitnehmer beim Online-Lernen, Bild: iStock.com, JLco - Julia Amaral,
nicht unter freier Lizenz
Jonas Durr arbeitet bei einem Pharmaunternehmen und muss für seinen Arbeitgeber regelmäßig an (Online-)Fortbildungen in unterschiedlichen Bereichen teilnehmen. Er stellt mit der Zeit bei sich fest, dass es ihm bei fachlichen Fortbildungen und wissenschaftlichen Austauschen sehr viel wichtiger ist, sein Wissen und Können zu zeigen als zum Beispiel bei Unterweisungen und IT-Lehrgängen, bei denen es nicht um Reputation und gute Ergebnisse geht. Er erinnert sich daran, dass es seinen Eltern besonders wichtig war, dass er in bestimmten Fächern gute Noten mit nach Hause brachte. Für gute Noten gab es zu Hause immer eine Belohnung, zum Beispiel durfte er sich sein Lieblingsessen wünschen.