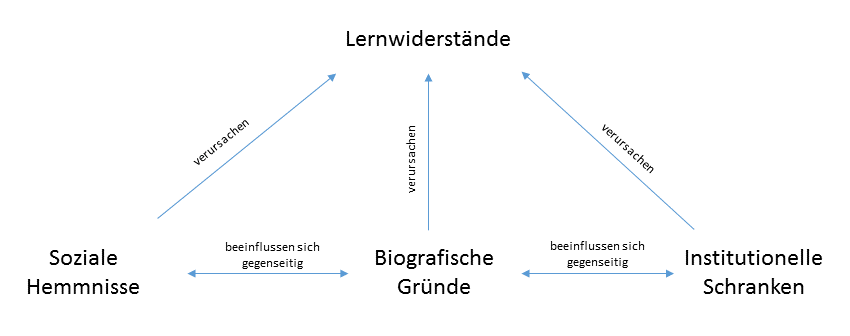Lernwiderstände und Digitalisierung
Ludwig und Grell (2017) betonen die besonderen Herausforderungen im Kontext einer digital geprägten Arbeitswelt, der sich Anbieter und Lehrende stellen und auf die gute Antworten gefunden werden müssen, wenn Lernen gelingen soll: "[...] mit Blick auf die bereits bestehenden Erkenntnisse der Forschung [ist] begründet zu erwarten, dass (nicht nur) niedrigqualifizierte Arbeitnehmer auf diese mit der Digitalisierung verbundenen Lernangebote, die als Eingriff in die Autonomie erlebt werden, mit Vermeidungsstrategien und Lernwiderständen reagieren. Das kontinuierliche Neu- oder Um-Lernen, das In-Frage-Stellen von (entlastenden) Routinen und die Entwertung vorgängiger Kompetenzen in der Arbeitswelt ist kritisch zu betrachten: In welcher Weise entsteht für die Beteiligten lediglich Anpassungsdruck, in welcher Weise wird Bildung zum bloßen „Schmiermittel“, um Konflikte zu mildern, und inwiefern können sich für die Beteiligten echte Bildungspotenziale eröffnen, die ihre Orientierungsmuster und Handlungsfähigkeiten in der (Arbeits-)Welt bereichern."