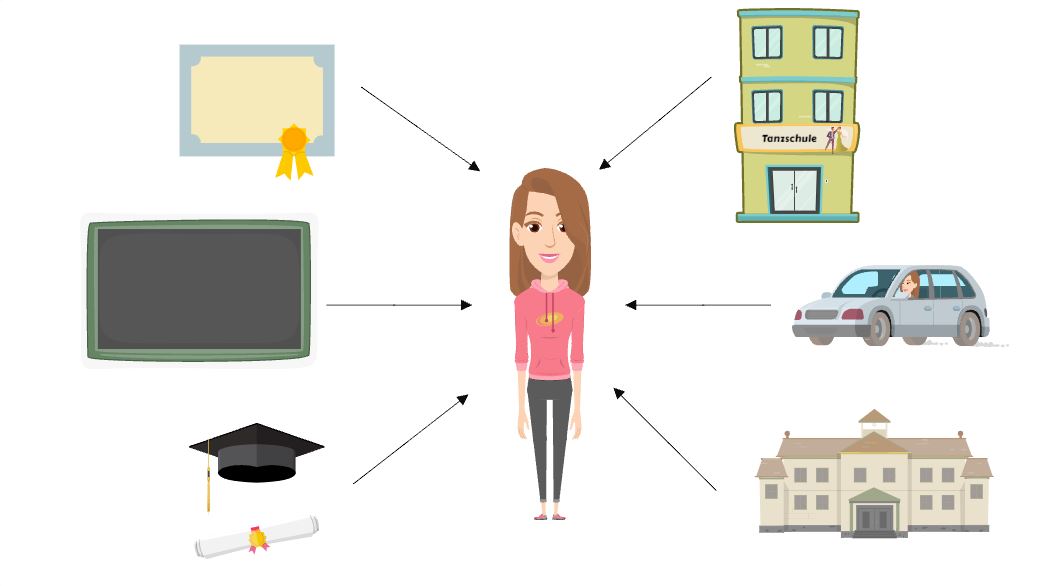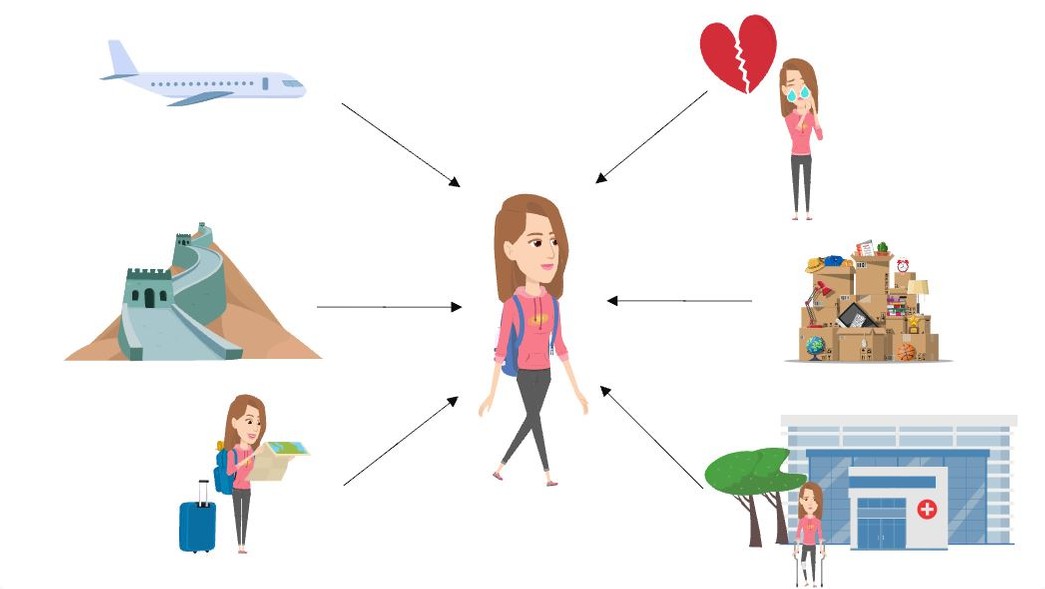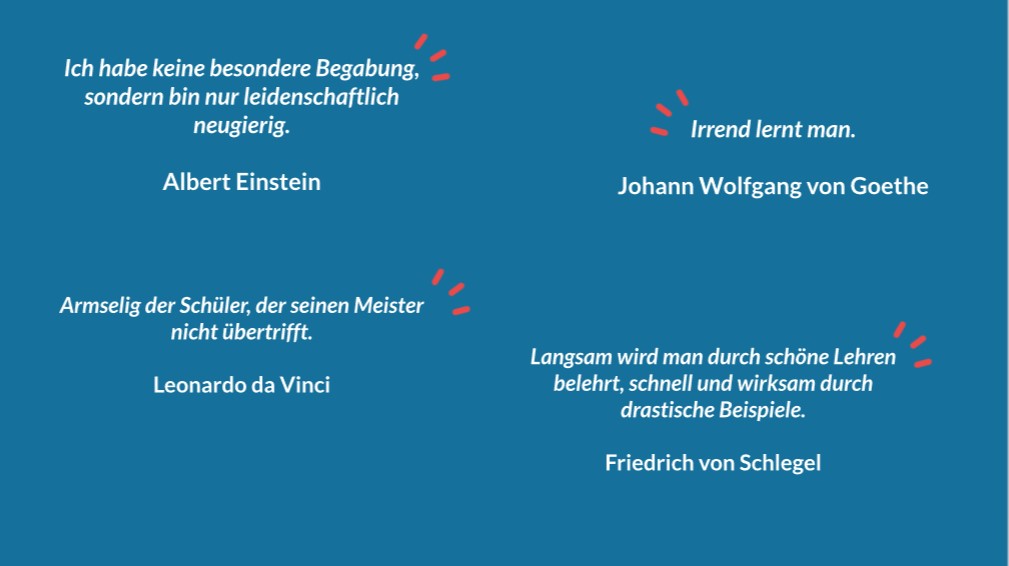Gutjons, H., Pieper, M. & Wagener, B. (2003). Auf meinen Spuren. Das Entdecken der eigenen Lebensgeschichte. Vorschläge und Übungen für pädagogische Arbeit und Selbsterfahrung (6. Aufl.). Hamburg: Bergmann + Helbig.
Klingenberger, H. (2007). Lebenslauf. 365 Schritte für neue Perspektiven. München: Don Bosco Verlag
Prüfwasser, J. (1998). Ein Traum von tausend Freiheiten oder Jede Biographie ist eine Bildungsbiographie. Forum-Informationen, 1998 (2), S. 6-8.
Reischmann, Jost (2009). Formen des Lernens Erwachsener. In: Fuhr, T., Gonon, P. & Hof, C. (Hrsg.). Handbuch der Erziehungswissenschaft, Band II/2 Erwachsenenbildung Weiterbildung (S. 851-862). Paderborn: Schöning.
Ruhe, H. G. (2014). Praxishandbuch Biografiearbeit. Methoden, Themen, Felder, Weinheim / Basel: Beltz Juventa.
Siebert, H. & Rohs, M. (2016). Lernen und Bildung Erwachsener (Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen - Grundlagen & Theorie). Bielefeld: wbv Media.