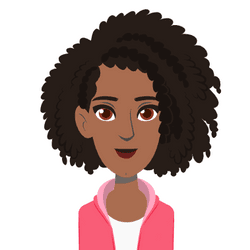Definition: Lehr-Lern-Prozesse
Als Lehr-Lern-Prozesse werden alle Bedingungen, Prozesse und Interaktionen einer (Online-) Weiterbildung verstanden, die das Ziel haben, das Lernen anzuregen und zu optimieren. Moderne Ansätze fokussieren hierbei auf unterschiedliche „Vermittlungs- und Übersetzungsprozesse“ (Witz, 2021) bei den Lernenden sowie die Art und Weise, wie diese durch Aktivitäten von Seiten der Lehrenden unterstützt werden können. „So geht das Angebots-Nutzungs-Modell davon aus, dass Lehrangebote nur dann zum Erfolg führen, wenn diese durch die Lernenden in angemessener Weise wahrgenommen, interpretiert und genutzt werden. Nur wenn bekannt ist, welche Prozesse beim Lernen ablaufen, ist effektives Lehren und Unterstützen möglich“ (ebenda).
„Alle Lehr-Lern-Prozesse sind an konkrete soziale Systeme [...] gekoppelt. Die Qualität [...] ist von Funktionalität vs. Dysfunktionalität solcher [Lern-]Systeme abhängig: Je „reibungsloser“ die Transaktionen im System verlaufen, desto effektiver werden [...] Lernprozesse sein. Kognitive und soziale Prozesse sind von daher nicht als voneinander unabhängige Bereiche anzusehen; Lehr- und Lernvariablen sind in komplexer Weise mit sozio-emotionalen Faktoren verknüpft“ (Brunner et al. 2009, S. 399).
Der Lehr-Lernprozess ist also ein dynamischer Prozess – es kommen ein Input (durch Lernmaterialien), die Verarbeitung durch die Lernenden, gegebenenfalls Interaktion sowie ein Output (zum Beispiel in Form von bestandenen Aufgaben) zusammen. Lehrende können den Lernprozess durch unterschiedliche Methoden und Ansätzen unterstützen, wie zum Beispiel durch klare Anweisungen oder Feedback.