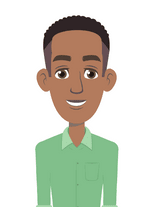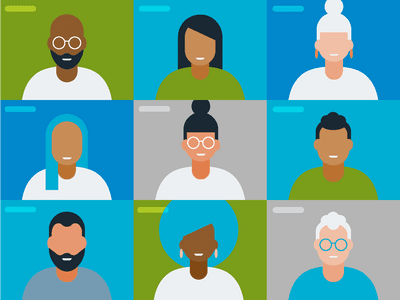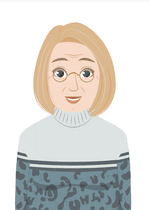
Frau Weber spricht hier über latente Differenzierung in ihrem Kurs:
„Ich gebe aktuell eine Online-Weiterbildung für berufstätige Erwachsene zum Thema Digitalmarketing. Es ist eine eher kleine Gruppe von fünf Teilnehmenden mit leicht unterschiedlichen Erfahrungen und Vorkenntnissen.
Mir ist es sehr wichtig, die Bedürfnisse aller Lernenden im Blick zu haben. Deshalb erklärte ich zu Beginn das Konzept des digitalen Marketings und gab ihnen im Anschluss eine Aufgabe zum Thema. Ich wusste jedoch, dass eine Teilnehmerin zum Beispiel das Tool, mit dem die Aufgabe umgesetzt werden sollte, noch nicht kannte. Und ein anderer Teilnehmer hatte mir vor der Weiterbildung mitgeteilt, dass es ihm manchmal schwer fällt, konzentriert in Stille an einer Aufgabe zu arbeiten. Deshalb habe ich alle gemeinsam die Aufgabe erledigen lassen und dann immer wieder individuelle Hinweise und Unterstützungen gegeben oder offene Fragen gestellt, die zur Lösung der Aufgabe beitrugen.
Es war ein schönes Gefühl, zu merken, dass alle nicht nur ihre digitalen Marketingkenntnisse verbessert haben, sondern auch ihren individuellen Bedürfnissen gerecht werden konnten.“