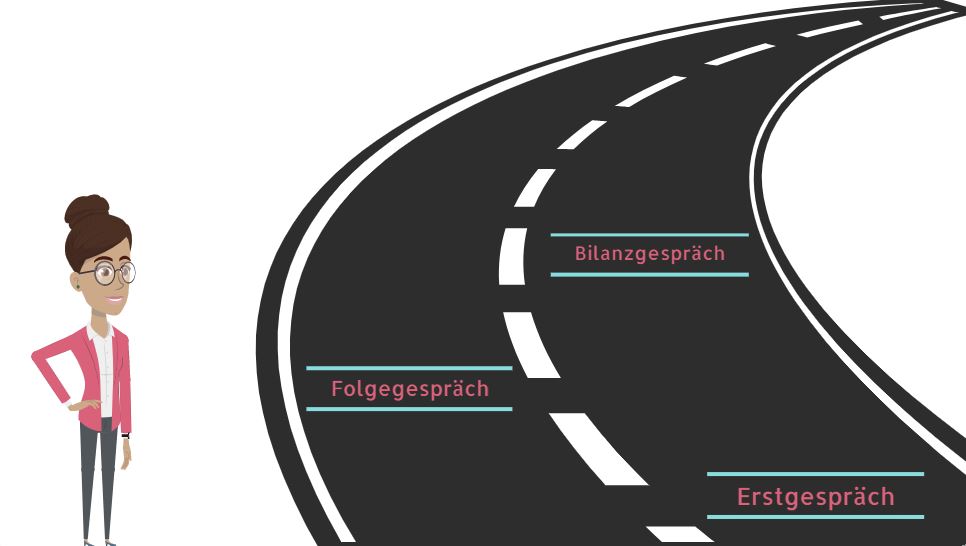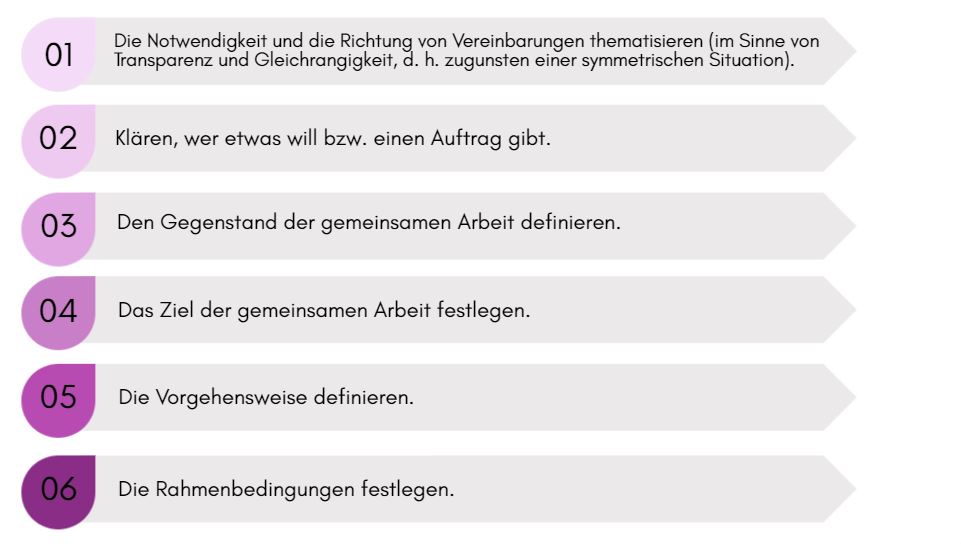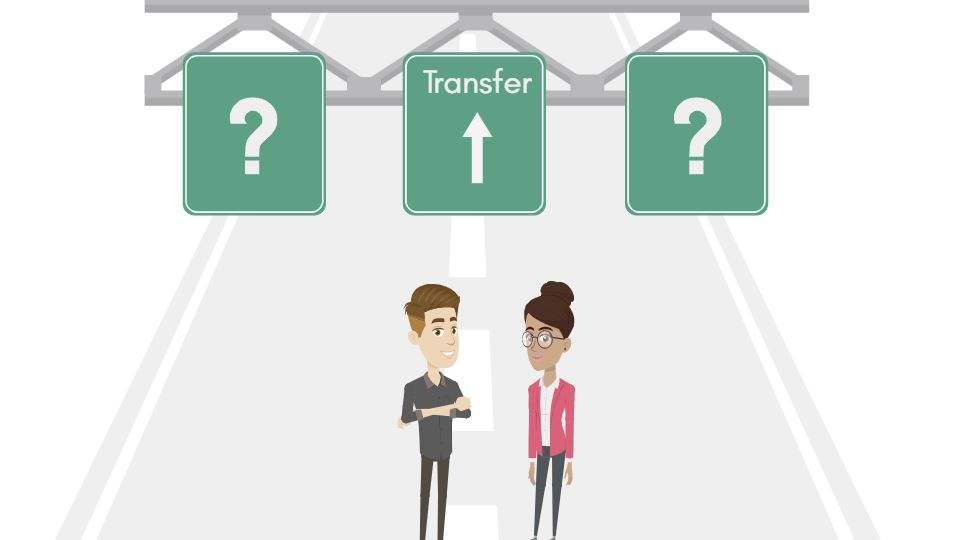Checkliste zur Gesprächsvorbereitung
Was Beratende tun können, um sich auf ein Beratungsgespräch vorzubereiten (nach Pantucek 1998):
- Die Gedanken an andere Aufgaben beiseitelegen und zum Beispiel den Schreibtisch von nicht relevanten Unterlagen freiräumen.
- Die bisherigen Unterlagen einsehen, wie Falldokumentation, Notizen und Vereinbarungen.
- Das Gespräch planen, abhängig vom Gesprächstyp (Erst-, Folge-, Bilanzgespräch)
- Eine ununterbrochene Gesprächszeit sicherstellen.
- Das Setting arrangieren: Ausreichend Stühle und eine entspannte, konzentrierte Gesprächsatmosphäre schaffen, nötige Unterlagen bereitlegen.